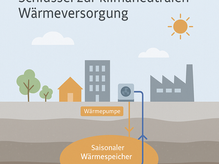Bildergalerie
zum Energiepolitischen Forum vom 17.2.2025


Die Energiepolitik und Gesetzgebung in Mitteldeutschland wird von der EU-, Bundes- und Landesebene beeinflusst, doch jedes Bundesland setzt individuelle Schwerpunkte, etwa durch spezifische Klimaschutzgesetze oder Förderprogramme, durch. Die Koordination der verschiedenen Ebenen zielt darauf ab, die Energieversorgung sicher, nachhaltig und wirtschaftlich zu gestalten, wobei der Strukturwandel nach dem Kohleausstieg ein zentraler Aspekt ist.
Hier ist eine Übersicht über die einschlägigen Regelwerke und Gesetze auf diesen Ebenen.
Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung 2022
Sachsen 14,2 %
Sachsen-Anhalt 60,1 %
Thüringen 63,8 %
Deutschland 44 %
Fakten zur
Energiepolitik
Thesaurus
der Energiepolitik
Das Klimageld ist ein Konzept, das in Deutschland und anderen Ländern diskutiert wird, um Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten, während der Staat Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vorantreibt. Es basiert auf der Idee, Einnahmen aus einer CO₂-Bepreisung direkt an die Bevölkerung zurückzugeben mit starkem Fokus auf die soziale Entlastung von Bürger*innen, insbesondere Haushalte mit geringem Einkommen. Im Unterschied zur Klimadividende lässt sie die Verwendung der Einnahmen für öffentliche Investitionen zu.
Funktionsweise des Klimagelds
-
CO₂-Bepreisung:
-
Unternehmen, die fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl oder Gas verwenden, zahlen eine Abgabe für jede ausgestoßene Tonne CO₂.
-
Diese Kosten werden oft an die Verbraucher weitergegeben, wodurch sich z. B. Heiz- und Kraftstoffpreise erhöhen.
-
-
Einnahmen des Staates:
-
Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung fließen in einen staatlichen Fonds.
-
-
Rückzahlung an die Bevölkerung:
-
Ein Teil oder die gesamten Einnahmen werden in Form eines pauschalen Klimageldes (oft auch Klimaprämie genannt) an die Bürgerinnen und Bürger ausgezahlt.
-
Alle erhalten denselben Betrag, unabhängig vom Einkommen oder Verbrauch.
-
Ziele des Klimagelds
-
Soziale Gerechtigkeit:
-
Menschen mit niedrigerem Einkommen profitieren besonders, da sie in der Regel weniger Energie verbrauchen und somit weniger von den höheren Preisen belastet werden. Sie erhalten dennoch die volle Prämie.
-
Haushalte mit hohem Energieverbrauch tragen mehr Kosten durch die CO₂-Bepreisung, erhalten aber auch nur das gleiche Klimageld, was einen Ausgleich schafft.
-
-
Anreiz zur CO₂-Reduktion:
-
Höhere Preise für fossile Energie motivieren Unternehmen und Haushalte, energieeffizientere Technologien oder erneuerbare Energien zu nutzen.
-
-
Förderung des Klimaschutzes:
-
Die Einnahmen aus der CO₂-Bepreisung finanzieren eine Maßnahme, die den Übergang zu einer klimafreundlicheren Gesellschaft sozialverträglich gestaltet.
-
Beispielrechnung
-
Angenommen, eine Familie zahlt aufgrund der CO₂-Abgabe im Jahr 300 Euro mehr für Heizkosten und Benzin. Das Klimageld beträgt jedoch 400 Euro pro Person. Wenn die Familie aus zwei Personen besteht, erhält sie insgesamt 800 Euro zurück. Sie hätte also einen Überschuss von 500 Euro.
Kritikpunkte
-
Bürokratie: Kritiker bemängeln, dass die Auszahlung des Klimageldes administrativen Aufwand mit sich bringt.
-
Effizienz: Manche argumentieren, dass die CO₂-Bepreisung nicht hoch genug ist, um einen starken Anreiz zur Reduktion der Emissionen zu setzen.
-
Deckelung der Kosten: In der Übergangszeit könnten einkommensschwache Haushalte dennoch kurzfristig stark belastet werden.
Fazit
Das Klimageld verbindet Klimaschutz mit sozialem Ausgleich. Es zielt darauf ab, die Belastung durch steigende Energiepreise gerechter zu verteilen und dabei klimafreundliches Verhalten zu fördern.
Energiepolitische Richtlinien
EU-Ebene
Die Gesetzgebung der Europäischen Union prägt die Energiepolitik maßgeblich, insbesondere durch verbindliche Richtlinien und Verordnungen:
Richtlinien und Verordnungen
-
Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II und RED III): Verpflichtung der Mitgliedstaaten, einen bestimmten Anteil an erneuerbaren Energien bis 2030 zu erreichen.
-
Energieeffizienzrichtlinie (EED): Zielvorgaben zur Senkung des Energieverbrauchs, u. a. durch Gebäuderenovierung und Effizienzsteigerungen.
-
EU-Emissionshandelssystem (EU ETS): Marktbasiertes Instrument zur Reduzierung von CO₂-Emissionen in der Energiewirtschaft und Industrie.
-
REPowerEU-Plan: Ziel der Diversifizierung der Energieversorgung und des beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energien als Reaktion auf die Energiekrise.
-
Verordnung über den CO₂-Grenzausgleich (CBAM): Einführung eines Mechanismus zur Vermeidung von „Carbon Leakage“ bei importierten Produkten.
-
TEN-E-Verordnung: Regelung zum Ausbau der transeuropäischen Energienetze (z. B. grenzüberschreitende Strom- und Gasleitungen).
Green Deal und Fit-for-55-Paket
-
Ziel der Klimaneutralität bis 2050: Rechtsverbindlich durch das Europäische Klimagesetz.
-
Fit-for-55-Paket: Reformen und Maßnahmen zur Senkung der Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 %.


Bundesebene (Deutschland)
Die deutsche Energiegesetzgebung setzt EU-Vorgaben um und entwickelt nationale Strategien:
Energie- und Klimaschutzgesetze
-
Klimaschutzgesetz (KSG): Nationale Klimaschutzziele, darunter eine CO₂-Reduktion von 65 % bis 2030 und Klimaneutralität bis 2045.
-
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG): Fördert den Ausbau erneuerbarer Energien durch Einspeisevergütungen, Marktprämien und Ausschreibungen.
-
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): Rechtsrahmen für den Betrieb von Anlagen, einschließlich Kraftwerken und Windparks.
-
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Wärme (GEG): Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden und die Nutzung erneuerbarer Energien.
Markt- und Infrastrukturregelungen
-
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG): Regelt den Betrieb und Ausbau von Energieinfrastruktur sowie den Zugang zu Strom- und Gasnetzen.
-
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG): Beschleunigt den Ausbau der Stromnetze, insbesondere für die Integration erneuerbarer Energien.
-
Wasserstoffstrategie: Förderprogramme und rechtliche Rahmenbedingungen zur Entwicklung einer Wasserstoffwirtschaft.
Förderprogramme
-
KfW-Programme: Finanzierung von energieeffizientem Bauen und Sanieren.
-
Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG): Zuschüsse für energieeffiziente Bauprojekte und Heizungsumstellungen.
-
Just Transition Fund (JTF): Unterstützung von Regionen im Strukturwandel, insbesondere in ehemaligen Kohlerevieren.
Landesebene (Mitteldeutschland: Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen)
Die Bundesländer in Mitteldeutschland setzen die Bundes- und EU-Regelungen um, entwickeln jedoch eigene Schwerpunkte:
Klimaschutz- und Energiegesetze
-
Sachsen:
-
Klimaschutz- und Energieprogramm Sachsen 2030: Strategische Ausrichtung der Energie- und Klimapolitik mit Zielen für Energieeffizienz und den Ausbau erneuerbarer Energien.
-
Förderrichtlinie für Energieeffizienz und erneuerbare Energien: Unterstützung von Unternehmen und Kommunen bei Investitionen in nachhaltige Technologien.
-
-
Sachsen-Anhalt:
-
Klimaschutz- und Energiekonzept (KEK) 2030: Fokussiert auf Windenergie, Solarenergie und Wasserstoffwirtschaft.
-
Gesetz zur Förderung erneuerbarer Energien: Landesrechtliche Umsetzung der Bundesziele.
-
-
Thüringen:
-
Thüringer Klimagesetz: Festlegung landesspezifischer Klimaziele, z. B. Reduzierung der Emissionen bis 2040 um 70 %.
-
Förderprogramm GreenTech Thüringen: Unterstützung von Energieinnovationen und nachhaltigen Technologien.
-
Strukturwandelprogramme
Die mitteldeutschen Bundesländer profitieren vom Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen, das im Zuge des deutschen Kohleausstiegs verabschiedet wurde. Wichtige Schwerpunkte:
-
Förderung von erneuerbaren Energien.
-
Schaffung von Arbeitsplätzen in der Wasserstoffwirtschaft.
-
Aufbau von Forschungszentren für nachhaltige Technologien (z. B. in Leipzig, Halle, Jena).

Sozioökonomischen
Projekttionsbericht
12/24 Die sozio-ökonomische Folgenabschätzung untersucht Veränderungen in den Sektoren Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr in Hinblick auf Investitionsbedarfe und Kosteneinsparungen sowie die gesamt-wirtschaftliche Wirkung. Die Analyse wird ergänzt durch die Abschätzung von Arbeitsmarkteffekten in ausgewählten Bereichen mit hohen Investitionsbedarfen und durch die Analyse von Verteilungs-wirkungen verschiedener Instrumente in den Sektoren Gebäude und Verkehr.
Wasseratlas 2025
01/25 Der von der Heinrich-Böll-Stiftung und Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. veröffentlichte Wasseratlas zeigt: Die Ressource Wasser ist nicht nur weltweit, sondern zunehmend auch in Deutschland bedroht. Grund dafür sind der hohe Wasserverbrauch der Landwirtschaft, zunehmende Bodenversiegelung und das schnelle Ableiten des Wassers vom Land ins Meer.

Marktanalysen
Grafiken zu Stromproduktion und Börsenstrompreisen
Die Rohdaten der Energy Charts werden von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE aus zahlreichen Quellen abgerufen und für die Darstellung aufbereitet.
From Ideas to Action -
impulses for successfully implementing NbS in cities
11/24 The report ‘From Ideas to Action’ from the Ecologic Institute presents the strategy papers of the seven INTERLACE partner cities, which were developed in close cooperation with local stakeholders in Europe and Latin America. These papers highlight tailor-made strategies for nature-based solutions (NbS), including the revitalisation of urban parks in Chemnitz and the development of a search engine for green infrastructure projects in Kraków. The aim is to effectively address the unique challenges of each city, such as climate change, biodiversity loss and social inequality.
European vehicle market statistics 2024/25 - International Council on Clean Transportation
The 2024/25 edition of European Vehicle Market Statistics offers a statistical portrait of passenger car, light commercial, and heavy-duty vehicle fleets
in the European Union (EU) from 2001 to 2023. It is focused on new vehicle registrations, technologies, fuel consumption, and tailpipe emissions.